Peter Ratzenbeck
letzte Aktualisierung: 18 Februar 2024
interview_acoustic
Interview in der Zeitschrift Akustik
Klangmaler Peter Ratzenbeck
Von Burkhardt van Hees
erschienen im Heft 98/03
Klangmaler Peter Ratzenbeck
Von Burkhardt van Hees
erschienen im Heft 98/03
Peter Ratzenbeck, geboren am 10.10.1955 in Graz, ist ein Musiker, der in die bereits bestehenden Klischees heimischer Provenienz und Prominenz nicht so recht einzuordnen ist. Er ist ein Musiker zum Anfassen, bodenständig und ohne Starallüren. Seine 13 bislang erschienenen Soloalben wurden von der Presse und dem Publikum mit Superlativen wie „Österreichs Paradegitarrist", „Mr. Fingerpicking" oder „Phänomen der Musiklandschaft" bedacht. Ratzenbeck genießt große Anerkennung in Fachkreisen und ist nicht nur wegen seiner exzellenten Musik, sondern besonders auch durch seinen österreichischen Charme und Witz beliebt.
Du hast eine über 20jährige Bühnenerfahrung als Musiker. Wann ging es los?
Peter Ratzenbeck: 1976 hatte ich mein erstes öffentliches Konzert in Bregenz als Newcomer und habe zum Glück sehr gut abgeschnitten. Bereits ein Jahr später war ich nicht mehr Newcomer, sondern bereits im Hauptprogramm. Zu diesem Zeitpunkt wurde die erste Platte produziert, die ich übrigens in acht Stunden eingespielt habe, mit insgesamt 16 Titeln. So klingt die Platte allerdings auch (lacht). Heute brauche ich für zwei bis drei Stücke acht Stunden. Aber nicht deshalb, weil ich sie immer falsch spiele, sondern um irgendwo die Einheit zwischen Feeling und technischer Perfektion zu erreichen.
Wie wirken diese alten Aufnahmen für dich heute?
P.R.: Ich stehe insofern dazu, als sie speziell die Stücke meiner damaligen Vorbilder widerspiegeln. Seinerzeit habe ich eben versucht, mit bestem Wissen und Gewissen Stücke zu intonieren und zu interpretieren. Es war die Zeit, die für mich musikalisch durch vier bis fünf Gitarristen bestimmt war. Ich sagte mir, bevor ich die Stücke nicht annähernd so spielen kann wie sie, wage ich mich nicht an eigene Kompositionen heran. Immerhin war ich erst 16 1/2 Jahre alt, als ich anfing, und hatte noch gar nicht das nötige Selbstbewußtsein für eigene Stücke. Da gab es Leo Kottke auf der 12saitigen Gitarre, der mich faszinierte, von Davey Graham das „Angie" oder von Werner Lämmerhirt das „Eleonor Rigby".
Du bist aber Autodidakt?
P.R.: Ich bin nach wie vor Autodidakt. Ich kann weder die Tonleiter noch sonst etwas. Die Gitarristen, die mir bis heute gut gefallen und mit denen ich auch nach all den Jahren immer wieder zusammenkomme, sind nach wie vor Autodidakten. Vielleicht ist das genau der Reiz, denn ich glaube, diese spezielle Musikrichtung erfordert nicht so sehr eine klassische Ausbildung.
Welche Herausforderung stellt sich für einen Autodidakten?
P.R.: Durch die fehlende musikalische Ausbildung brauchst du viel Disziplin, um das eigene Naturell aufzubauen. Würde ich jetzt zehn Jahre eine bestimmte Richtung in der Musik studieren, wäre der Stempel des Lehrers oder des Professors sehr vordergründig. Um mich von diesem Stigma zu lösen, müßte ich viel Energie aufbringen. Irgendwie läuft man Gefahr, genauso zu klingen wie ein anderer Schüler. Das fällt alles weg, wenn du völlig alleine und unbeeinflußt von einem Lehrer mit dem Instrument herausgefordert bist. So ist die Wahrscheinlichkeit, daß dein eigenes Naturell zum Vorschein kommt, viel größer. Wenn die Technik, die von Jahr zu Jahr ausgefeilter wird, auch noch funktioniert, dann hat man so etwas wie einen unverkennbaren Stil. Das bin ich, so klinge ich, egal wie gut oder technisch die anderen klingen mögen, die eben studiert haben. Wenn du nicht deine eigene Richtung entwickelst, wirst du deinen Vorbildern gegenüber immer in Haßliebe enden. Die Unverkennbarkeit des Interpreten sollte es eigentlich geben, und dahin geht seit nahezu zehn Jahren meine Intention. Du stehst als Musiker irgendwann vor einem inneren Aufbäumen, in dem du dir sagst: „Schluß jetzt mit dem Nachspielen und Interpretieren, du bist ja auch da, und jetzt wird es Zeit, den kreativen Punkt in dir zu entdecken".
Zu Beginn deiner Karriere hattest du zu Werner Lämmerhirt Kontakt, wie kam es dazu?
P.R.: Das erste einschneidende Erlebnis, nach meinen ersten Jahren des Alleinspielens, war die Zusammenarbeit mit Werner Lämmerhirt. Ich habe in Nürnberg, im „Zündholz" gespielt. Werner und sein damaliger Manager Richard Schütz saßen in der ersten Reihe im Publikum. Im Anschluß an das Konzert fragten sie mich, ob ich für die geplante Live-Tournee die zweite Gitarre spielen wolle. Ich bin aus allen Wolken gefallen und habe natürlich zugesagt. Vor der Tournee war ich bei Werner in Bodenwerter in seinem noch nicht fertig renovierten Haus, in dem wir in einem Raum ohne Möbel zu viert, mit dem Saxophonisten Joe und dem Bassisten Michael Erhard, für die Tournee geprobt haben.
Durch diese Zusammenarbeit und durch gemeinsame Studioaufnahmen entstand für mich auch spielerisch eine neue Herausforderung. So habe ich Geschwindigkeit auf der Gitarre neu gelernt - besonders mit der rechten Hand. Ich spielte bei Werner als zweiter Gitarrist. Er spielt übrigens auch eine Komposition von mir auf der Platte „White Spots", den „Ötters Blues". Ich habe ihn damals mit dem Gitarrenbauer Roland Ötter in Nürnberg zusammengebracht. Und dann haben wir gemeinsam den „Ötters Blues" auf der Platte eingespielt, der übrigens nach wie vor, wenn ich ihn mir anhöre, sehr lustig ist. Er schlägt zwar aus der Kerbe, nämlich weg vom Normalen, was Werner so spielt, deutet aber irgendwie peripher schon das an, was ich später weiter verfolgt habe.
Thema Geschwindigkeit. Ist es möglicherweise eine Generationsfrage - früher war es die Geschwindigkeit auf der Gitarre, die zählte, heute dominieren die ruhigen Stücke?
P.R.: Ja, das ist sicherlich altersmäßig bestimmt. Andererseits, als ich damals anfing, habe ich primär Lämmerhirt und Kottke gehört, auch wegen der geringen Auswahl an Platten, die mir zur Verfügung standen. Für mich war es fast unumgänglich, daß ich so schnell und ruppig sein wollte wie zum Beispiel Kottke. Besonders bei Live-Auftritten erzielte ich mit den schnelleren Stücken größeren Enthusiasmus als bei langsameren Stücken. Das heißt, eine schnell herumgezupfte Nummer war irgendwo immer ein Synonym für große Euphorien, aber vor allem auch das Akzeptieren der eigenen Stücke. Ich spiele heute bei Konzerten ungefähr ein Drittel extrem schnelle Sachen, ein Drittel dazwischenliegende und ein Drittel extrem langsame Stücke.
Beim Anhören deiner letzten drei CDs bekommt man dennoch einen völlig anderen Eindruck, nämlich, daß die langsamen Stücke überwiegen.
P.R.: Das stimmt! Auf den CDs bekomme ich die Perfektion der ganzen Hammerings und Pull-Offs viel präziser hin als auf der Bühne. Das heißt, auf der Bühne kann es schon sein, daß da und dort eine Option nicht zu 100 Prozent gekommen ist. Bei den schnellen Stücken kann nicht viel passieren, da geht es fast immer zu 99 Prozent gut. Die ruhigen Stücke sind aber eine Facette von mir, die immer in mir vorhanden war, nur jetzt kultiviert, als zweite Seite der Medaille dasteht. Würde ich jetzt nur ruhige Stücke spielen, dann hätte ich immer das Gefühl, es würde mir etwas fehlen. Dennoch habe ich viel Spaß an den ruhigen Stücken - zum Beispiel die „Waldviertler Nächte": Wenn ich mir das Stück anhöre, ist das Glücksgefühl größer als bei einem schnellen Stück. Schnell spielen ist ein mechanisches Üben des Wechselbasses. Geht der einmal gut, das heißt kombiniert mit Läufen, ist es ein abgenutzter Hut. Bei alten Stücken kannst du mit dem Tempo viel schöner spielen, beschleunigen, verzögern, akzentuieren. Das setzt voraus, daß ich keine Fingerpicks benutze, sondern nur mit den Fingerkuppen spiele, um die Saiten eben nuancierter anzureißen.
Du verstehst dich in den verschiedensten Stilrichtungen, ob österreichische Mundart, New Age oder die Vorliebe für irische Musik, Folk und Blues, Ragtime und gelegentlich auch klassische Stilelemente. Ist dein Repertoire bewußt so breit angelegt?
P.R.: Bevor ich hauptsächlich solo gespielt habe, habe ich bereits mit Musikern wie STS zusammengespielt, mit Wilfried, Boris Bukowski, Magic. Graz war damals die Liedermacher-Hochburg in der Steiermark. Schließlich habe ich auch mitgesungen. Es ist mir immer ein Anliegen gewesen, mehr zu singen. Ich habe mir das aber verkniffen, weil ich immer das Gefühl hatte, meine Stimme ist in keiner Weise in der Lage, mit meinem Gitarrenspiel mitzuhalten. Meine Tendenz, etwas perfekt zu machen, scheiterte also meist daran, wenn ich dazu singen wollte. Wenn ich singe, wird es live akzeptiert. Dennoch belasse ich es meist bei drei bis vier Stücken, die dann als Auffrischung zu verstehen sind. Obwohl ich gerne mehr singen wollte, das gebe ich schon zu. Bei meinen neueren CDs aber wäre das nicht typisch für das, was ich immer gemacht habe, nämlich primär Gitarrist zu sein. Soviel also zur Frage des möglichen „schlummernden Liedermachers".
Nun zu deiner Frage nach dem Repertoire. Ich versuche, eine Vielseitigkeit zu bringen, die keine völlige Unterordnung bedeutet, also den eigenen roten Faden durchblicken läßt. Das heißt, ich mag die Vielseitigkeit, mit Ausnahme von reiner Klassik und reinem Jazz. Ich höre mir nur sehr selten Gitarrenplatten an. Ich bin nicht einer, der daheim sitzt und grübelt und tüftelt und hört, wie macht der das, und wie geht das und wie auch immer. Ich höre gerne irische oder klassische Musik, dennoch: meinen Gitarrenstil möchte ich so unbeeinflußt wie möglich von anderen Gitarristen halten.
Die zweite Frage war die irische Facette. Ich stand vor zehn Jahren vor der Entscheidung, ob ich mich in die diffizile Welt des Ragtime und des Swing/Jazz ein wenig weiter vorwagen sollte. Das hätte dann aber unweigerlich bedeutet, daß ich Noten lernen müßte. Schließlich entschied ich mich für die melodiösere Seite, die ich leichter verstehe, nämlich die irische Musik. Hierzu trugen einige einschneidende Erfahrungen bei, insbesondere die Freundschaft zu Andy Irvin 1980. Andy spielte zwar Bouzuki und Mandoline. Aber mit seinen alten traditionellen irischen Liedern fühlte ich mich sofort in diese Richtung gezogen. Hinzu kommen meine gelegentlichen Reisen nach Irland, die damals noch ohne Konzerte verliefen. Ich bin zwar immer nur an die Westküste und nach Dublin gefahren, aber ich habe dabei das Lebensgefühl, die Musikrichtung und die Menschen Irlands kennengelernt. Das hat schon viel ausgemacht. Wenn es ein zweites Land neben Österreich gäbe, wäre das sicherlich Irland, wo ich ohne Heimweh leben könnte. Kein anderer Fleck auf der Welt, nur Irland und speziell dort an der Westküste.
Sind es vielleicht auch die alte Tradition und die Mystik, die dich an Irland binden?
P.R.: Die Merkwürdigkeit der Affinität ist irgendwo gar nicht verbal zu erklären, weil es ein tiefes inneres Gefühl ist. Ich rede jetzt nicht so, um mich vor der Antwort zu drücken, aber es gibt Dinge, die kann ich nicht definieren, weil sie gefühlsmäßig verankert sind. Es gibt Melodien, da zieht es mir alles zusammen, und ich kann mir nicht erklären, warum das so ist.
Du wohnst in Österreich, in Waldviertel, abgelegen, mitten in der Natur. Ist da für dich auch das irische Ambiente spürbar und daher bewußt der Ort gewählt - also auch ein Ort, um dort deine Musik entstehen zu lassen?
P.R.: Es mag unbewußt eine Rolle gespielt haben, daß meine Wahl genau innerhalb Österreichs auf den entlegensten, landschaftlich und sogar klimatisch ähnlich gelagerten Punkt zu Irland fiel und ich mich dorthin zurückgezogen habe.
Wie anfangs erwähnt, sprach ich über den Musiker Ratzenbeck, der sich einfärbt in die verschiedenen Nuancen akustischer Musik und Stilrichtungen. Eine dieser Färbungen ist sicher auch die klassische Inspiration?
P.R.: Das rührt daher, daß ich sehr viel Barockmusik höre. Ich kann zwar kein einziges Barockstück spielen, aber die rhythmischen Betonungen und die Phrasierungen bleiben sehr wohl in meinem Kopf hängen. Wenn ich einen Griff auf der Gitarre finde, der zu Zweidritteln schon nach einem Barock-Akkord klingt, suche ich mir das letzte Drittel absichtlich, damit ich genau den Klang auf der Gitarre finde. Ich verfolge also bewußt das Klangbild, das in meinem Kopf vorhanden ist.
An welche Klassiker denkst du dabei?
P.R.: Bach! Na, das ist klar, den habe ich genug strapaziert. Aber es gab zum Beispiel auch einen französischen Lautenspieler, Francoise Default, aus dem 16./17. Jahrhundert. Er hat im Gegensatz zu Bach die Laute immer in eine Mollstimmung gesetzt und sie extrem tief nach unten gestimmt. Das hat mich fasziniert. Weil ich die Gitarre schon immer sehr gerne auf C-Stimmung gespielt habe, habe ich bei seinen Stücken erkannt, daß er diese Stimmung auf der Laute in Mollstimmung benutzt. Das sind unheimlich langsame, fast düster klingende Kompositionen. Durch das sehr intensive Anhören seiner Stücke ist eine Affinität, fast insgeheim eine Zugehörigkeit, entstanden.
New Age ist ein schon etwas strapazierter Begriff, aber für die Gitarre ein interessanter Aspekt?
P.R.: Ich kann mich erinnern, auf meinen ersten Schallplatten, zumindest auf der "Sugar & Spice", sind zwei Stücke, die erst im Studio entstanden sind. Diese beiden Stücke wären zehn Jahre später sicher unter dem Begriff "New Age" gelaufen. Ähnliche Stücke hat es auch auf nachfolgenden Platten von mir gegeben. Ich bin ja kein Techniker. Ich war immer eher auf der phantastischen Seite. Das prägt natürlich auch mein Bewußtsein und sozusagen meine Einstellung zum Spielen. Wenn ich zu Hause für mich Gitarre spiele und eine Kerze vor mir steht, gönne ich es mir, minutenlang auf einem Akkord zu spielen, um den Klang zu genießen. Ich gehe jetzt nicht hin und spiele mir selbst die Ohren wund, sondern ich koste einzelne Akkorde aus. Manchmal wird ein Stück daraus, manchmal belasse ich es nur beim Genuß. Ich kann also mit meinen alten Schallplatten dokumentieren, daß ich schon sehr früh New Age gemacht habe, als es den Begriff noch gar nicht gab.
Was ist deine Intention, mit anderen Leuten zusammenzuspielen? Nicht nur auf deinen CDs, sondern auch auf der Bühne kann man dich mit anderen Musikern erleben.
P.R.: Für die Live-Auftritte bin ich zu 50 Prozent beteiligt, wobei ich mir die Musiker bewußt aussuche. ich versuche auch dem Publikum ein größeres Spektrum anzubieten. Da ich bei 80 Prozent meiner Konzerte im Jahr immer alleine unterwegs bin, ist es für mich ungemein fein, dann auf der Bühne mit zwei oder drei anderen Musikern zu sitzen, wobei jeder auf seinem Gebiet unverkennbar ist.
Wie kann man sich den Übergang vom Solo-Interpreten bis hin zum Duo oder Trio vorstellen?
P.R.: Streß gibt es dann, wenn ich parallel zum Mitspielen die Gitarre umstimmen muß, das Mischpult gleichzeitig betätigen muß und dazwischen vielleicht noch etwas ansage. Speziell bei Colin Wilkie ist es ja so, daß er bei den Gitarrenstimmungen nicht sehr akribisch ist, das heißt, ich muß seine Gitarren auch noch zwischendurch stimmen. Dies verzögert und schafft Streß. Wenn eine externe Anlage da ist und einer am Mischpult alles regelt, ist es dennoch ein Genuß´.
Mit Colin bist du in der Vergangenheit bereits öfters live aufgetreten, kann das auch einmal mit jemanden passieren, mit dem du noch nicht zusammengespielt hast?
P.R.: Ja, warum nicht. Für Allan Taylor habe ich einige Konzerte in Österreich organisiert. ich kann mir gut vorstellen, bei dem einen oder anderen Konzert zwei bis drei Stücke mit ihm zu spielen. Das ergibt sich dann. ich habe bereits mit ihm schon vor einiger Zeit in Wien im Metropol gespielt, da waren wir mit Hans Theessink sogar zu dritt. Bei meinen Stücken kann ich es mir hingegen nicht vorstellen, daß jemand mitspielt. Bei den gesungenen Nummern ist es für mich aber auch eine große Ehre und Freude. ich suche mir immer Leute aus, die vom Niveau und vom Können her dazu passen.
Benutzt du eine besondere Spieltechnik?
P.R.: Wenn ich es jetzt rückblickend betrachte, war es wohl eher so, daß ich darauf geachtet habe, daß die rechte Hand dominiert. Das heißt, ich habe mit der linken Hand eher mal einen Schlendrian dazwischen gehabt. Bei dem Stück "Kaliyuga Express" (auf der CD "Travelogue", d. Red.) bin ich rechts dauernd unterwegs und links auch. Es gibt keine hunderstel Sekunde, in der ich nichts machen muß. Trotzdem versuche ich, das in eine Melodie zu bringen, damit es nicht konfus wird. Es ist die größere Kunst, Teile wegzustreichen und den Kern der Melodie, der mir vorschwebt, auszuarbeiten. "Kaliyuga Express" hat über ein Jahr gedauert, bis ich es fertig hatte. Da habe ich in Dublin in der Jugendherberge genauso geübt wie im Sommer zwischen den Seminaren. Von 20 Versionen, die bis dahin entstanden sind, schneide ich dann das weg, was Ballast ist. Ich gebe keine Ruhe, bis ich alles ausgeschöpft habe, was an Möglichkeiten vorhanden ist. Ich habe weniger das Problem, keine Ideen zu haben. Eher besteht das Problem darin, aus den vielen Ideen das Wesentliche auszufiltern.
Thema "Open Tunings". Deine Stücke sind bekanntlich durchwegs in offenen Stimmungen gespielt. Von dir bevorzugt sind Kreationen in der C-Stimmung. Die Meinung über offene Stimmungen wird teilweise auch sehr kritisch beurteilt. Einige sagen, ein guter Gitarrist brauche keine offenen Stimmung, oder: "Mit offener Stimmung spielen, das kann doch jeder!" Ist das ein Vorurteil?
P.R.: Ich habe immer versucht, meine Musik von der größten Einfachheit her aufzubauen. Für mich sind die C-Dur-Stimmung und die vielen Ableger, die ich daraus kreiere, schwerpunktmäßig meine Basis zum Komponieren. Wenn der Kapo dabei auf dem 4. Bund sitzt, bekommt die Gitarre eine ganz eigene Schwingung, einen besonderen singenden Ton. Jedes Stück ist dabei so schwer, wie du es machst. Das hat nichts mit der offenen Stimmung zu tun. Du kannst ein Klavier einfach oder schwierig spielen, das hängt nur von demjenigen ab, der davor sitzt und was er daraus macht: ob er Musik mit Melodie machen oder ob er nur virtuos glänzen will.
Du gibst im Jahr über 100 Konzerte, vornehmlich in Österreich. Das scheint mir für einen Akustikgitarristen relativ viel zu sein. Sind deine Landsleute in Österreich besonders auf akustische Musik fixiert?
P.R.: Ja, ich komme ungefähr auf 100 Konzerte im Jahr. Hinzu kommen die Gitarrenseminare. Seit den letzten Jahren halte ich im Jahr ungefähr 15 bis 17 Seminare. Davon dauern einige eine ganze Woche, andere wiederum finden manchmal an einem Tag statt. Bevor ich noch keine Seminare gab, hatte ich sogar bis 200 Konzerte im Jahr.
Bist du ein Unruhegeist, also eine Art Workaholic?
P.R.: Zwei Monate im Jahr unbedingt! In dieser Zeit blitzt genau das durch, was ich mir so in den Anfangsjahren immer als Stundenplan auferlegt habe. Und zwar deswegen, weil ich von Mitte Dezember bis Mitte Februar die Winterpause bewußt so lang gestalte, um die Ideen, die im Jahr entstehen und die ich aber im Jahr nie imstande bin ausführen, genau in diesem Zeitraum zu konkretisieren. Ich gebe keine Ruhe, mit dem neuen Stücken fertig zuwerden, bevor die Winterpause zu Ende geht. Das bedeutet dann, daß ich oft von 11 Uhr nachts bis 4 oder 5 Uhr früh arbeite. Da verfliegen die Stunden, da bin ich wie in einem Trancezustand. Diese zwei Monate im Jahr nehme ich bewußt als Übungszeit. Während des Jahres bin ich zu abgelenkt und froh, wenn ich kurzfristig Ideen auf einem Minidisc aufspielen kann, besonders, wenn ich eine neue Gitarrenstimmung gefunden haben.
Kommen wir auf die sehr schönen Harfenstücke deiner Frau zu sprechen. habt ihr beiden nicht schon einmal daran gedacht, eine gemeinsame CD nur mit Harfen und Gitarrenmusik zu veröffentlichen?
P.R.: Gedacht habe ich daran schon oft. Aber meine Frau ist in dieser Hinsicht überhaupt nicht leicht dazu zu bewegen. Erstens ins Studio zu gehen und zweitens ein Stück öfters als zehnmal einzuspielen. Also von mir aus sofort. Die Überredungskünste, die ich benötige, um sie ins Studio förmlich zu drängen, kosten mich viel Energie. Ich möchte meine Frau gerne bei den Aufnahmen dabeihaben, nicht nur deshalb, weil sie meine Frau ist, sondern weil es mir sehr gefällt, was sie macht.
Viel Glück und vielen Dank für das Gespräch.
Du hast eine über 20jährige Bühnenerfahrung als Musiker. Wann ging es los?
Peter Ratzenbeck: 1976 hatte ich mein erstes öffentliches Konzert in Bregenz als Newcomer und habe zum Glück sehr gut abgeschnitten. Bereits ein Jahr später war ich nicht mehr Newcomer, sondern bereits im Hauptprogramm. Zu diesem Zeitpunkt wurde die erste Platte produziert, die ich übrigens in acht Stunden eingespielt habe, mit insgesamt 16 Titeln. So klingt die Platte allerdings auch (lacht). Heute brauche ich für zwei bis drei Stücke acht Stunden. Aber nicht deshalb, weil ich sie immer falsch spiele, sondern um irgendwo die Einheit zwischen Feeling und technischer Perfektion zu erreichen.
Wie wirken diese alten Aufnahmen für dich heute?
P.R.: Ich stehe insofern dazu, als sie speziell die Stücke meiner damaligen Vorbilder widerspiegeln. Seinerzeit habe ich eben versucht, mit bestem Wissen und Gewissen Stücke zu intonieren und zu interpretieren. Es war die Zeit, die für mich musikalisch durch vier bis fünf Gitarristen bestimmt war. Ich sagte mir, bevor ich die Stücke nicht annähernd so spielen kann wie sie, wage ich mich nicht an eigene Kompositionen heran. Immerhin war ich erst 16 1/2 Jahre alt, als ich anfing, und hatte noch gar nicht das nötige Selbstbewußtsein für eigene Stücke. Da gab es Leo Kottke auf der 12saitigen Gitarre, der mich faszinierte, von Davey Graham das „Angie" oder von Werner Lämmerhirt das „Eleonor Rigby".
Du bist aber Autodidakt?
P.R.: Ich bin nach wie vor Autodidakt. Ich kann weder die Tonleiter noch sonst etwas. Die Gitarristen, die mir bis heute gut gefallen und mit denen ich auch nach all den Jahren immer wieder zusammenkomme, sind nach wie vor Autodidakten. Vielleicht ist das genau der Reiz, denn ich glaube, diese spezielle Musikrichtung erfordert nicht so sehr eine klassische Ausbildung.
Welche Herausforderung stellt sich für einen Autodidakten?
P.R.: Durch die fehlende musikalische Ausbildung brauchst du viel Disziplin, um das eigene Naturell aufzubauen. Würde ich jetzt zehn Jahre eine bestimmte Richtung in der Musik studieren, wäre der Stempel des Lehrers oder des Professors sehr vordergründig. Um mich von diesem Stigma zu lösen, müßte ich viel Energie aufbringen. Irgendwie läuft man Gefahr, genauso zu klingen wie ein anderer Schüler. Das fällt alles weg, wenn du völlig alleine und unbeeinflußt von einem Lehrer mit dem Instrument herausgefordert bist. So ist die Wahrscheinlichkeit, daß dein eigenes Naturell zum Vorschein kommt, viel größer. Wenn die Technik, die von Jahr zu Jahr ausgefeilter wird, auch noch funktioniert, dann hat man so etwas wie einen unverkennbaren Stil. Das bin ich, so klinge ich, egal wie gut oder technisch die anderen klingen mögen, die eben studiert haben. Wenn du nicht deine eigene Richtung entwickelst, wirst du deinen Vorbildern gegenüber immer in Haßliebe enden. Die Unverkennbarkeit des Interpreten sollte es eigentlich geben, und dahin geht seit nahezu zehn Jahren meine Intention. Du stehst als Musiker irgendwann vor einem inneren Aufbäumen, in dem du dir sagst: „Schluß jetzt mit dem Nachspielen und Interpretieren, du bist ja auch da, und jetzt wird es Zeit, den kreativen Punkt in dir zu entdecken".
Zu Beginn deiner Karriere hattest du zu Werner Lämmerhirt Kontakt, wie kam es dazu?
P.R.: Das erste einschneidende Erlebnis, nach meinen ersten Jahren des Alleinspielens, war die Zusammenarbeit mit Werner Lämmerhirt. Ich habe in Nürnberg, im „Zündholz" gespielt. Werner und sein damaliger Manager Richard Schütz saßen in der ersten Reihe im Publikum. Im Anschluß an das Konzert fragten sie mich, ob ich für die geplante Live-Tournee die zweite Gitarre spielen wolle. Ich bin aus allen Wolken gefallen und habe natürlich zugesagt. Vor der Tournee war ich bei Werner in Bodenwerter in seinem noch nicht fertig renovierten Haus, in dem wir in einem Raum ohne Möbel zu viert, mit dem Saxophonisten Joe und dem Bassisten Michael Erhard, für die Tournee geprobt haben.
Durch diese Zusammenarbeit und durch gemeinsame Studioaufnahmen entstand für mich auch spielerisch eine neue Herausforderung. So habe ich Geschwindigkeit auf der Gitarre neu gelernt - besonders mit der rechten Hand. Ich spielte bei Werner als zweiter Gitarrist. Er spielt übrigens auch eine Komposition von mir auf der Platte „White Spots", den „Ötters Blues". Ich habe ihn damals mit dem Gitarrenbauer Roland Ötter in Nürnberg zusammengebracht. Und dann haben wir gemeinsam den „Ötters Blues" auf der Platte eingespielt, der übrigens nach wie vor, wenn ich ihn mir anhöre, sehr lustig ist. Er schlägt zwar aus der Kerbe, nämlich weg vom Normalen, was Werner so spielt, deutet aber irgendwie peripher schon das an, was ich später weiter verfolgt habe.
Thema Geschwindigkeit. Ist es möglicherweise eine Generationsfrage - früher war es die Geschwindigkeit auf der Gitarre, die zählte, heute dominieren die ruhigen Stücke?
P.R.: Ja, das ist sicherlich altersmäßig bestimmt. Andererseits, als ich damals anfing, habe ich primär Lämmerhirt und Kottke gehört, auch wegen der geringen Auswahl an Platten, die mir zur Verfügung standen. Für mich war es fast unumgänglich, daß ich so schnell und ruppig sein wollte wie zum Beispiel Kottke. Besonders bei Live-Auftritten erzielte ich mit den schnelleren Stücken größeren Enthusiasmus als bei langsameren Stücken. Das heißt, eine schnell herumgezupfte Nummer war irgendwo immer ein Synonym für große Euphorien, aber vor allem auch das Akzeptieren der eigenen Stücke. Ich spiele heute bei Konzerten ungefähr ein Drittel extrem schnelle Sachen, ein Drittel dazwischenliegende und ein Drittel extrem langsame Stücke.
Beim Anhören deiner letzten drei CDs bekommt man dennoch einen völlig anderen Eindruck, nämlich, daß die langsamen Stücke überwiegen.
P.R.: Das stimmt! Auf den CDs bekomme ich die Perfektion der ganzen Hammerings und Pull-Offs viel präziser hin als auf der Bühne. Das heißt, auf der Bühne kann es schon sein, daß da und dort eine Option nicht zu 100 Prozent gekommen ist. Bei den schnellen Stücken kann nicht viel passieren, da geht es fast immer zu 99 Prozent gut. Die ruhigen Stücke sind aber eine Facette von mir, die immer in mir vorhanden war, nur jetzt kultiviert, als zweite Seite der Medaille dasteht. Würde ich jetzt nur ruhige Stücke spielen, dann hätte ich immer das Gefühl, es würde mir etwas fehlen. Dennoch habe ich viel Spaß an den ruhigen Stücken - zum Beispiel die „Waldviertler Nächte": Wenn ich mir das Stück anhöre, ist das Glücksgefühl größer als bei einem schnellen Stück. Schnell spielen ist ein mechanisches Üben des Wechselbasses. Geht der einmal gut, das heißt kombiniert mit Läufen, ist es ein abgenutzter Hut. Bei alten Stücken kannst du mit dem Tempo viel schöner spielen, beschleunigen, verzögern, akzentuieren. Das setzt voraus, daß ich keine Fingerpicks benutze, sondern nur mit den Fingerkuppen spiele, um die Saiten eben nuancierter anzureißen.
Du verstehst dich in den verschiedensten Stilrichtungen, ob österreichische Mundart, New Age oder die Vorliebe für irische Musik, Folk und Blues, Ragtime und gelegentlich auch klassische Stilelemente. Ist dein Repertoire bewußt so breit angelegt?
P.R.: Bevor ich hauptsächlich solo gespielt habe, habe ich bereits mit Musikern wie STS zusammengespielt, mit Wilfried, Boris Bukowski, Magic. Graz war damals die Liedermacher-Hochburg in der Steiermark. Schließlich habe ich auch mitgesungen. Es ist mir immer ein Anliegen gewesen, mehr zu singen. Ich habe mir das aber verkniffen, weil ich immer das Gefühl hatte, meine Stimme ist in keiner Weise in der Lage, mit meinem Gitarrenspiel mitzuhalten. Meine Tendenz, etwas perfekt zu machen, scheiterte also meist daran, wenn ich dazu singen wollte. Wenn ich singe, wird es live akzeptiert. Dennoch belasse ich es meist bei drei bis vier Stücken, die dann als Auffrischung zu verstehen sind. Obwohl ich gerne mehr singen wollte, das gebe ich schon zu. Bei meinen neueren CDs aber wäre das nicht typisch für das, was ich immer gemacht habe, nämlich primär Gitarrist zu sein. Soviel also zur Frage des möglichen „schlummernden Liedermachers".
Nun zu deiner Frage nach dem Repertoire. Ich versuche, eine Vielseitigkeit zu bringen, die keine völlige Unterordnung bedeutet, also den eigenen roten Faden durchblicken läßt. Das heißt, ich mag die Vielseitigkeit, mit Ausnahme von reiner Klassik und reinem Jazz. Ich höre mir nur sehr selten Gitarrenplatten an. Ich bin nicht einer, der daheim sitzt und grübelt und tüftelt und hört, wie macht der das, und wie geht das und wie auch immer. Ich höre gerne irische oder klassische Musik, dennoch: meinen Gitarrenstil möchte ich so unbeeinflußt wie möglich von anderen Gitarristen halten.
Die zweite Frage war die irische Facette. Ich stand vor zehn Jahren vor der Entscheidung, ob ich mich in die diffizile Welt des Ragtime und des Swing/Jazz ein wenig weiter vorwagen sollte. Das hätte dann aber unweigerlich bedeutet, daß ich Noten lernen müßte. Schließlich entschied ich mich für die melodiösere Seite, die ich leichter verstehe, nämlich die irische Musik. Hierzu trugen einige einschneidende Erfahrungen bei, insbesondere die Freundschaft zu Andy Irvin 1980. Andy spielte zwar Bouzuki und Mandoline. Aber mit seinen alten traditionellen irischen Liedern fühlte ich mich sofort in diese Richtung gezogen. Hinzu kommen meine gelegentlichen Reisen nach Irland, die damals noch ohne Konzerte verliefen. Ich bin zwar immer nur an die Westküste und nach Dublin gefahren, aber ich habe dabei das Lebensgefühl, die Musikrichtung und die Menschen Irlands kennengelernt. Das hat schon viel ausgemacht. Wenn es ein zweites Land neben Österreich gäbe, wäre das sicherlich Irland, wo ich ohne Heimweh leben könnte. Kein anderer Fleck auf der Welt, nur Irland und speziell dort an der Westküste.
Sind es vielleicht auch die alte Tradition und die Mystik, die dich an Irland binden?
P.R.: Die Merkwürdigkeit der Affinität ist irgendwo gar nicht verbal zu erklären, weil es ein tiefes inneres Gefühl ist. Ich rede jetzt nicht so, um mich vor der Antwort zu drücken, aber es gibt Dinge, die kann ich nicht definieren, weil sie gefühlsmäßig verankert sind. Es gibt Melodien, da zieht es mir alles zusammen, und ich kann mir nicht erklären, warum das so ist.
Du wohnst in Österreich, in Waldviertel, abgelegen, mitten in der Natur. Ist da für dich auch das irische Ambiente spürbar und daher bewußt der Ort gewählt - also auch ein Ort, um dort deine Musik entstehen zu lassen?
P.R.: Es mag unbewußt eine Rolle gespielt haben, daß meine Wahl genau innerhalb Österreichs auf den entlegensten, landschaftlich und sogar klimatisch ähnlich gelagerten Punkt zu Irland fiel und ich mich dorthin zurückgezogen habe.
Wie anfangs erwähnt, sprach ich über den Musiker Ratzenbeck, der sich einfärbt in die verschiedenen Nuancen akustischer Musik und Stilrichtungen. Eine dieser Färbungen ist sicher auch die klassische Inspiration?
P.R.: Das rührt daher, daß ich sehr viel Barockmusik höre. Ich kann zwar kein einziges Barockstück spielen, aber die rhythmischen Betonungen und die Phrasierungen bleiben sehr wohl in meinem Kopf hängen. Wenn ich einen Griff auf der Gitarre finde, der zu Zweidritteln schon nach einem Barock-Akkord klingt, suche ich mir das letzte Drittel absichtlich, damit ich genau den Klang auf der Gitarre finde. Ich verfolge also bewußt das Klangbild, das in meinem Kopf vorhanden ist.
An welche Klassiker denkst du dabei?
P.R.: Bach! Na, das ist klar, den habe ich genug strapaziert. Aber es gab zum Beispiel auch einen französischen Lautenspieler, Francoise Default, aus dem 16./17. Jahrhundert. Er hat im Gegensatz zu Bach die Laute immer in eine Mollstimmung gesetzt und sie extrem tief nach unten gestimmt. Das hat mich fasziniert. Weil ich die Gitarre schon immer sehr gerne auf C-Stimmung gespielt habe, habe ich bei seinen Stücken erkannt, daß er diese Stimmung auf der Laute in Mollstimmung benutzt. Das sind unheimlich langsame, fast düster klingende Kompositionen. Durch das sehr intensive Anhören seiner Stücke ist eine Affinität, fast insgeheim eine Zugehörigkeit, entstanden.
New Age ist ein schon etwas strapazierter Begriff, aber für die Gitarre ein interessanter Aspekt?
P.R.: Ich kann mich erinnern, auf meinen ersten Schallplatten, zumindest auf der "Sugar & Spice", sind zwei Stücke, die erst im Studio entstanden sind. Diese beiden Stücke wären zehn Jahre später sicher unter dem Begriff "New Age" gelaufen. Ähnliche Stücke hat es auch auf nachfolgenden Platten von mir gegeben. Ich bin ja kein Techniker. Ich war immer eher auf der phantastischen Seite. Das prägt natürlich auch mein Bewußtsein und sozusagen meine Einstellung zum Spielen. Wenn ich zu Hause für mich Gitarre spiele und eine Kerze vor mir steht, gönne ich es mir, minutenlang auf einem Akkord zu spielen, um den Klang zu genießen. Ich gehe jetzt nicht hin und spiele mir selbst die Ohren wund, sondern ich koste einzelne Akkorde aus. Manchmal wird ein Stück daraus, manchmal belasse ich es nur beim Genuß. Ich kann also mit meinen alten Schallplatten dokumentieren, daß ich schon sehr früh New Age gemacht habe, als es den Begriff noch gar nicht gab.
Was ist deine Intention, mit anderen Leuten zusammenzuspielen? Nicht nur auf deinen CDs, sondern auch auf der Bühne kann man dich mit anderen Musikern erleben.
P.R.: Für die Live-Auftritte bin ich zu 50 Prozent beteiligt, wobei ich mir die Musiker bewußt aussuche. ich versuche auch dem Publikum ein größeres Spektrum anzubieten. Da ich bei 80 Prozent meiner Konzerte im Jahr immer alleine unterwegs bin, ist es für mich ungemein fein, dann auf der Bühne mit zwei oder drei anderen Musikern zu sitzen, wobei jeder auf seinem Gebiet unverkennbar ist.
Wie kann man sich den Übergang vom Solo-Interpreten bis hin zum Duo oder Trio vorstellen?
P.R.: Streß gibt es dann, wenn ich parallel zum Mitspielen die Gitarre umstimmen muß, das Mischpult gleichzeitig betätigen muß und dazwischen vielleicht noch etwas ansage. Speziell bei Colin Wilkie ist es ja so, daß er bei den Gitarrenstimmungen nicht sehr akribisch ist, das heißt, ich muß seine Gitarren auch noch zwischendurch stimmen. Dies verzögert und schafft Streß. Wenn eine externe Anlage da ist und einer am Mischpult alles regelt, ist es dennoch ein Genuß´.
Mit Colin bist du in der Vergangenheit bereits öfters live aufgetreten, kann das auch einmal mit jemanden passieren, mit dem du noch nicht zusammengespielt hast?
P.R.: Ja, warum nicht. Für Allan Taylor habe ich einige Konzerte in Österreich organisiert. ich kann mir gut vorstellen, bei dem einen oder anderen Konzert zwei bis drei Stücke mit ihm zu spielen. Das ergibt sich dann. ich habe bereits mit ihm schon vor einiger Zeit in Wien im Metropol gespielt, da waren wir mit Hans Theessink sogar zu dritt. Bei meinen Stücken kann ich es mir hingegen nicht vorstellen, daß jemand mitspielt. Bei den gesungenen Nummern ist es für mich aber auch eine große Ehre und Freude. ich suche mir immer Leute aus, die vom Niveau und vom Können her dazu passen.
Benutzt du eine besondere Spieltechnik?
P.R.: Wenn ich es jetzt rückblickend betrachte, war es wohl eher so, daß ich darauf geachtet habe, daß die rechte Hand dominiert. Das heißt, ich habe mit der linken Hand eher mal einen Schlendrian dazwischen gehabt. Bei dem Stück "Kaliyuga Express" (auf der CD "Travelogue", d. Red.) bin ich rechts dauernd unterwegs und links auch. Es gibt keine hunderstel Sekunde, in der ich nichts machen muß. Trotzdem versuche ich, das in eine Melodie zu bringen, damit es nicht konfus wird. Es ist die größere Kunst, Teile wegzustreichen und den Kern der Melodie, der mir vorschwebt, auszuarbeiten. "Kaliyuga Express" hat über ein Jahr gedauert, bis ich es fertig hatte. Da habe ich in Dublin in der Jugendherberge genauso geübt wie im Sommer zwischen den Seminaren. Von 20 Versionen, die bis dahin entstanden sind, schneide ich dann das weg, was Ballast ist. Ich gebe keine Ruhe, bis ich alles ausgeschöpft habe, was an Möglichkeiten vorhanden ist. Ich habe weniger das Problem, keine Ideen zu haben. Eher besteht das Problem darin, aus den vielen Ideen das Wesentliche auszufiltern.
Thema "Open Tunings". Deine Stücke sind bekanntlich durchwegs in offenen Stimmungen gespielt. Von dir bevorzugt sind Kreationen in der C-Stimmung. Die Meinung über offene Stimmungen wird teilweise auch sehr kritisch beurteilt. Einige sagen, ein guter Gitarrist brauche keine offenen Stimmung, oder: "Mit offener Stimmung spielen, das kann doch jeder!" Ist das ein Vorurteil?
P.R.: Ich habe immer versucht, meine Musik von der größten Einfachheit her aufzubauen. Für mich sind die C-Dur-Stimmung und die vielen Ableger, die ich daraus kreiere, schwerpunktmäßig meine Basis zum Komponieren. Wenn der Kapo dabei auf dem 4. Bund sitzt, bekommt die Gitarre eine ganz eigene Schwingung, einen besonderen singenden Ton. Jedes Stück ist dabei so schwer, wie du es machst. Das hat nichts mit der offenen Stimmung zu tun. Du kannst ein Klavier einfach oder schwierig spielen, das hängt nur von demjenigen ab, der davor sitzt und was er daraus macht: ob er Musik mit Melodie machen oder ob er nur virtuos glänzen will.
Du gibst im Jahr über 100 Konzerte, vornehmlich in Österreich. Das scheint mir für einen Akustikgitarristen relativ viel zu sein. Sind deine Landsleute in Österreich besonders auf akustische Musik fixiert?
P.R.: Ja, ich komme ungefähr auf 100 Konzerte im Jahr. Hinzu kommen die Gitarrenseminare. Seit den letzten Jahren halte ich im Jahr ungefähr 15 bis 17 Seminare. Davon dauern einige eine ganze Woche, andere wiederum finden manchmal an einem Tag statt. Bevor ich noch keine Seminare gab, hatte ich sogar bis 200 Konzerte im Jahr.
Bist du ein Unruhegeist, also eine Art Workaholic?
P.R.: Zwei Monate im Jahr unbedingt! In dieser Zeit blitzt genau das durch, was ich mir so in den Anfangsjahren immer als Stundenplan auferlegt habe. Und zwar deswegen, weil ich von Mitte Dezember bis Mitte Februar die Winterpause bewußt so lang gestalte, um die Ideen, die im Jahr entstehen und die ich aber im Jahr nie imstande bin ausführen, genau in diesem Zeitraum zu konkretisieren. Ich gebe keine Ruhe, mit dem neuen Stücken fertig zuwerden, bevor die Winterpause zu Ende geht. Das bedeutet dann, daß ich oft von 11 Uhr nachts bis 4 oder 5 Uhr früh arbeite. Da verfliegen die Stunden, da bin ich wie in einem Trancezustand. Diese zwei Monate im Jahr nehme ich bewußt als Übungszeit. Während des Jahres bin ich zu abgelenkt und froh, wenn ich kurzfristig Ideen auf einem Minidisc aufspielen kann, besonders, wenn ich eine neue Gitarrenstimmung gefunden haben.
Kommen wir auf die sehr schönen Harfenstücke deiner Frau zu sprechen. habt ihr beiden nicht schon einmal daran gedacht, eine gemeinsame CD nur mit Harfen und Gitarrenmusik zu veröffentlichen?
P.R.: Gedacht habe ich daran schon oft. Aber meine Frau ist in dieser Hinsicht überhaupt nicht leicht dazu zu bewegen. Erstens ins Studio zu gehen und zweitens ein Stück öfters als zehnmal einzuspielen. Also von mir aus sofort. Die Überredungskünste, die ich benötige, um sie ins Studio förmlich zu drängen, kosten mich viel Energie. Ich möchte meine Frau gerne bei den Aufnahmen dabeihaben, nicht nur deshalb, weil sie meine Frau ist, sondern weil es mir sehr gefällt, was sie macht.
Viel Glück und vielen Dank für das Gespräch.
-
Argonaut
aufgenommen 2015 im Tonstudio Wavegarden, Tontechnik Franz Schaden, graphische Gestaltung Heimo Gladik
-
Spheres
aufgenommen 2012 im Tonstudio Wavegarden, Tontechnik Franz Schaden, graphische Gestaltung Heimo Gladik
-

Strinbbound
aufgenommen 2009 im Tonstudio Reitmann, Tontechnik Franz Reitmann, graphische Gestaltung Heimo Gladik
-
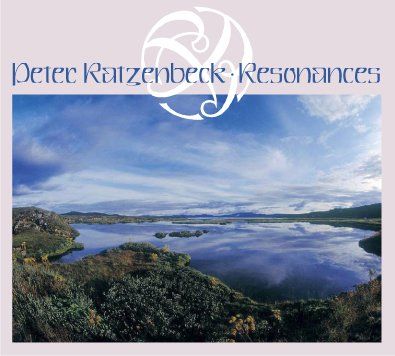
Resonances
aufgenommen 2005 in Nordengland, Brampton. Produzent Michael Chapman
-
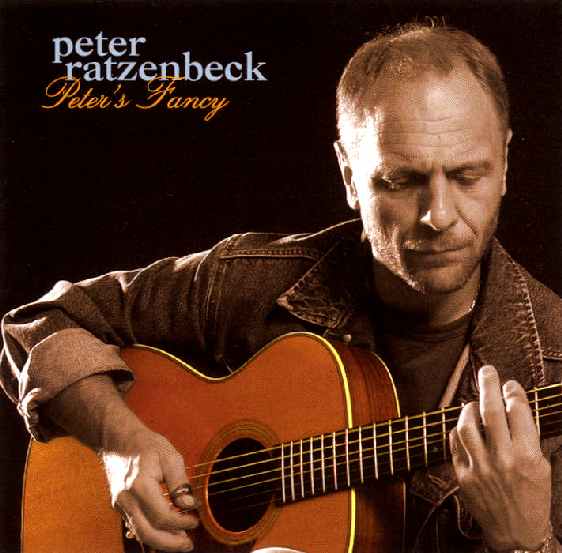
Peters Fancy
aufgenommen 2001 bei Stockfisch, Tontechniker Günther Paula, Fotos und graphische Gestaltung Klaus Bauer
-
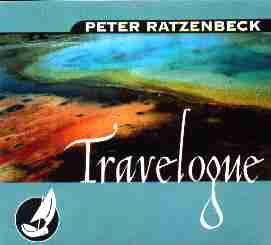
Travelogue
aufgenommen 1998, erschienen unter dem Label Shamrock
-
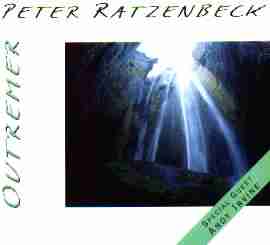
Outremer
aufgenommen 1995, erschienen unter dem Label Shamrock
-
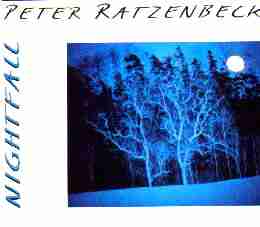
Nightfall
aufgenommen 1992, erschienen unter dem Label Shamrock
-
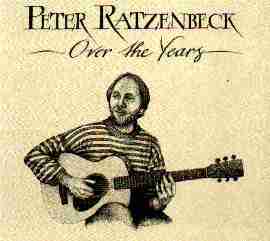
Over The Years
aufgenommen 1991, erschienen unter dem Label Shamrock
Alle anzeigen

